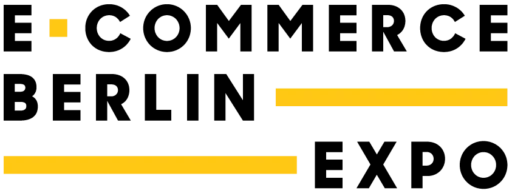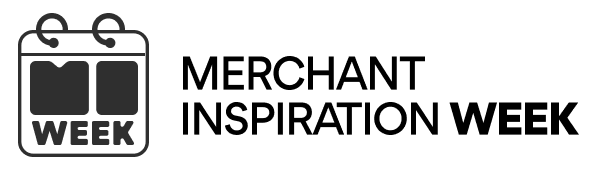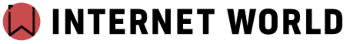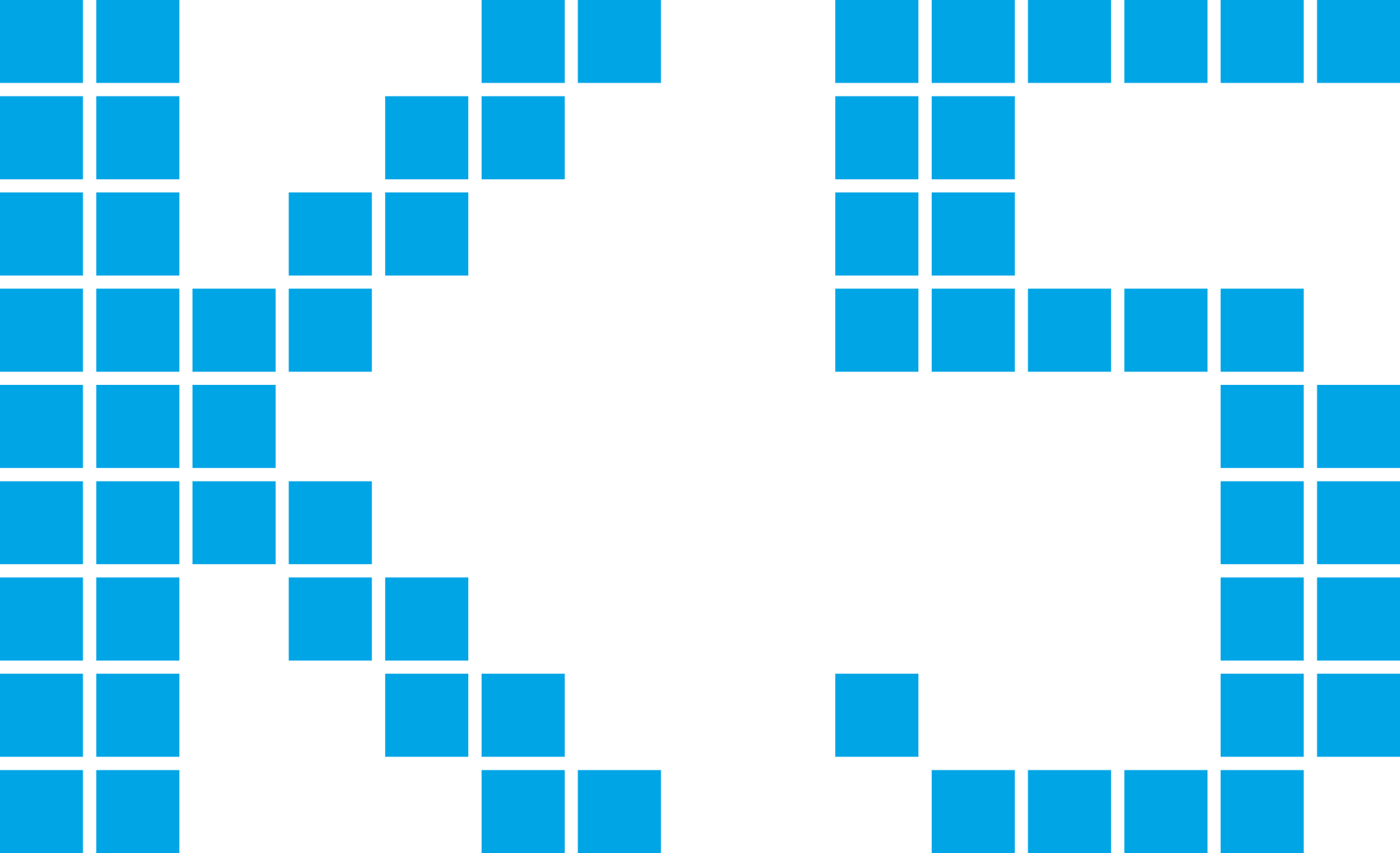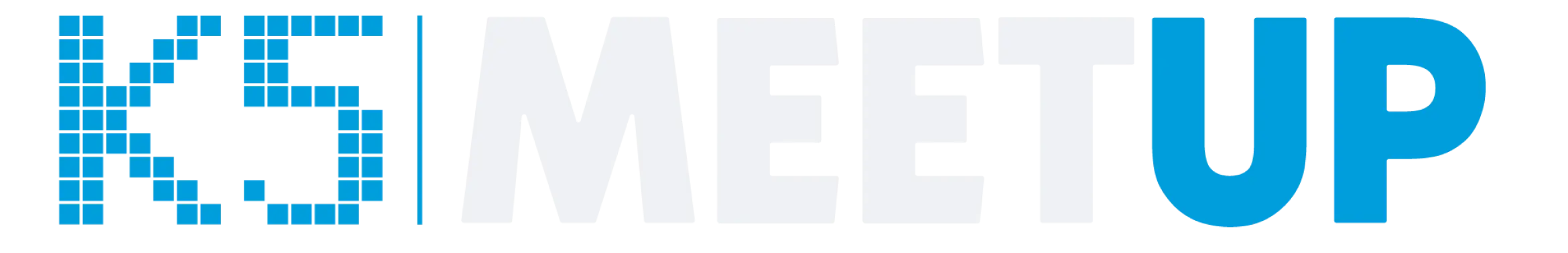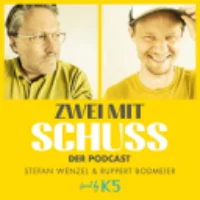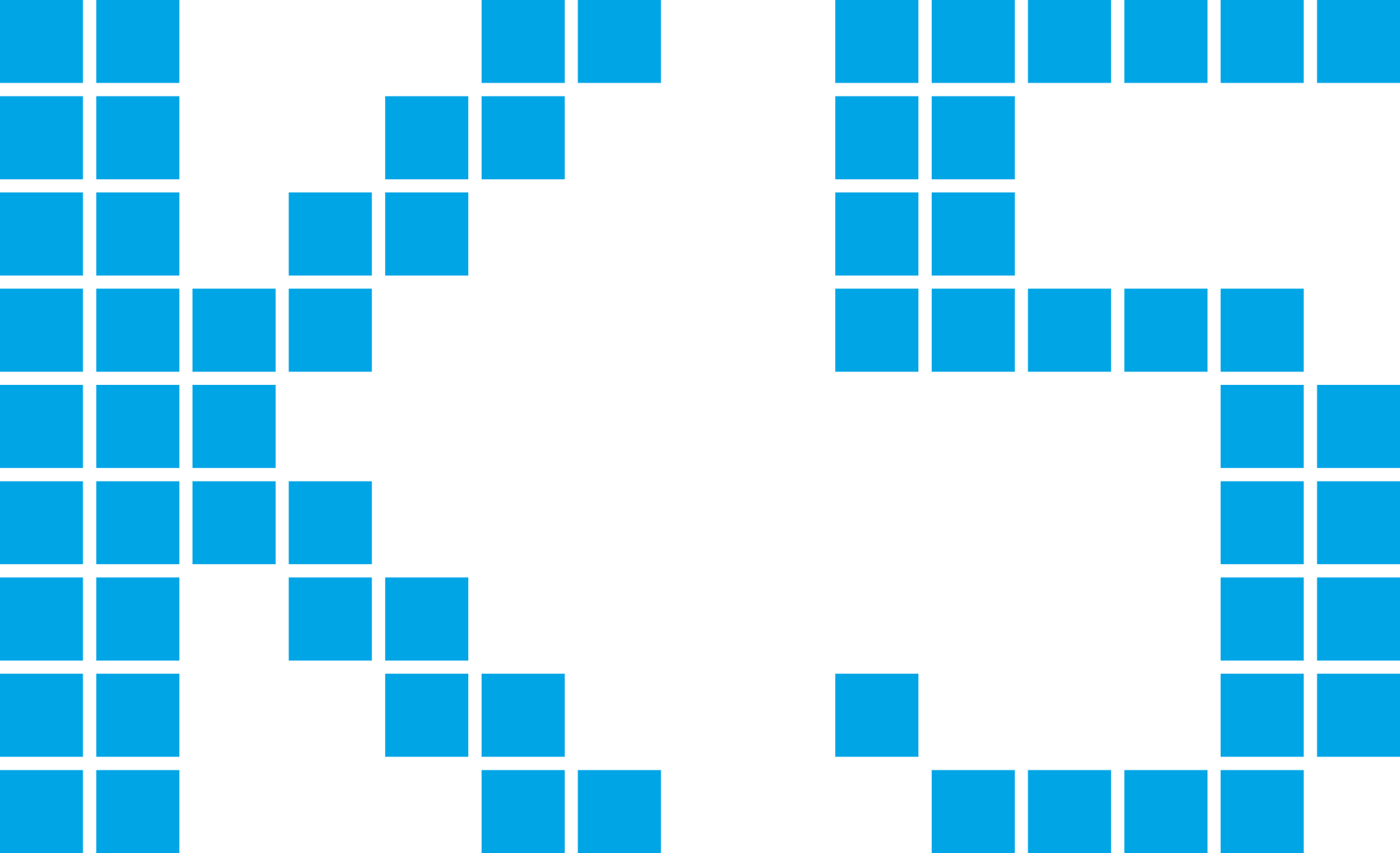Dr. Matthias Schu
Jahrzehntelange praktische Erfahrung in der E-Food-Branche und ein umfassender theoretischer Einblick machen Dr. Matthias Schu zu einem der führenden deutschsprachigen Experten der E-Food-Branche. Nach zahlreichen leitenden Positionen in Deutschland und der Schweiz, Matthias war u.a. für Praktiker, Coop, Interdiscount und SBB Consulting tätig, teilt er seit 2020 sein umfangreiches Wissen als Dozent an der Hochschule Luzern sowie als Gastdozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Neben der Lehrtätigkeit ist Dr. Matthias Schu auch ein renommierter Berater, dessen Expertise und Fokus neben der E-Food-Branche auch der Plattformökonomie, den Omnichannel- und den Vertriebsstrategien gelten. Seine umfassende Expertise führt Matthias auch immer wieder als Speaker auf die Bühnen des Onlinehandels, wie z.B. auf die der K5 Konferenzen 2022 und 2023.